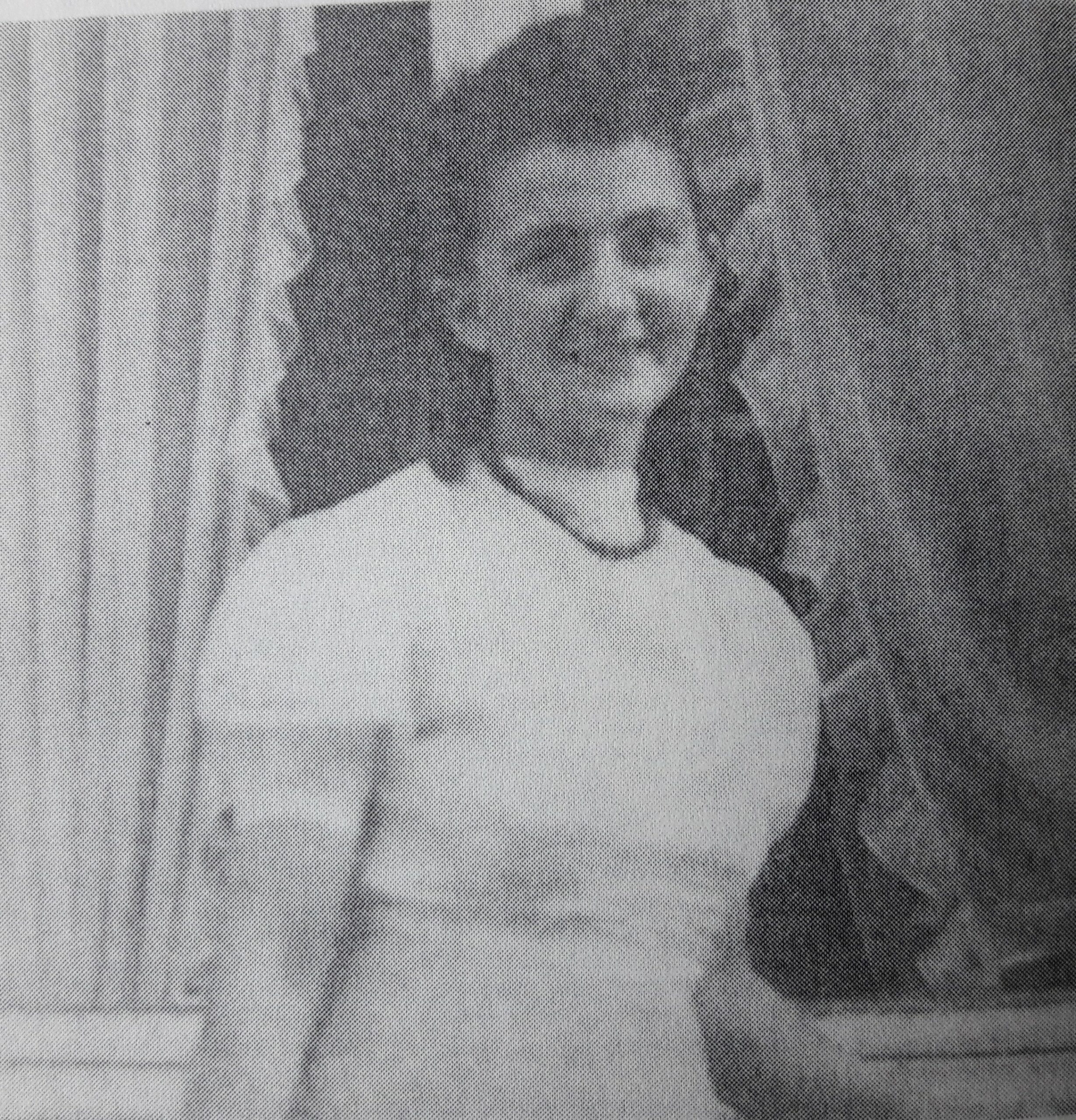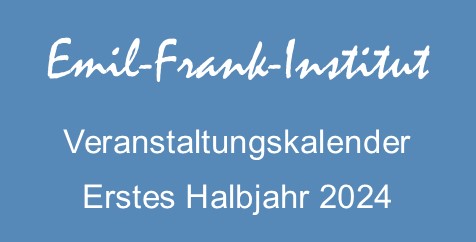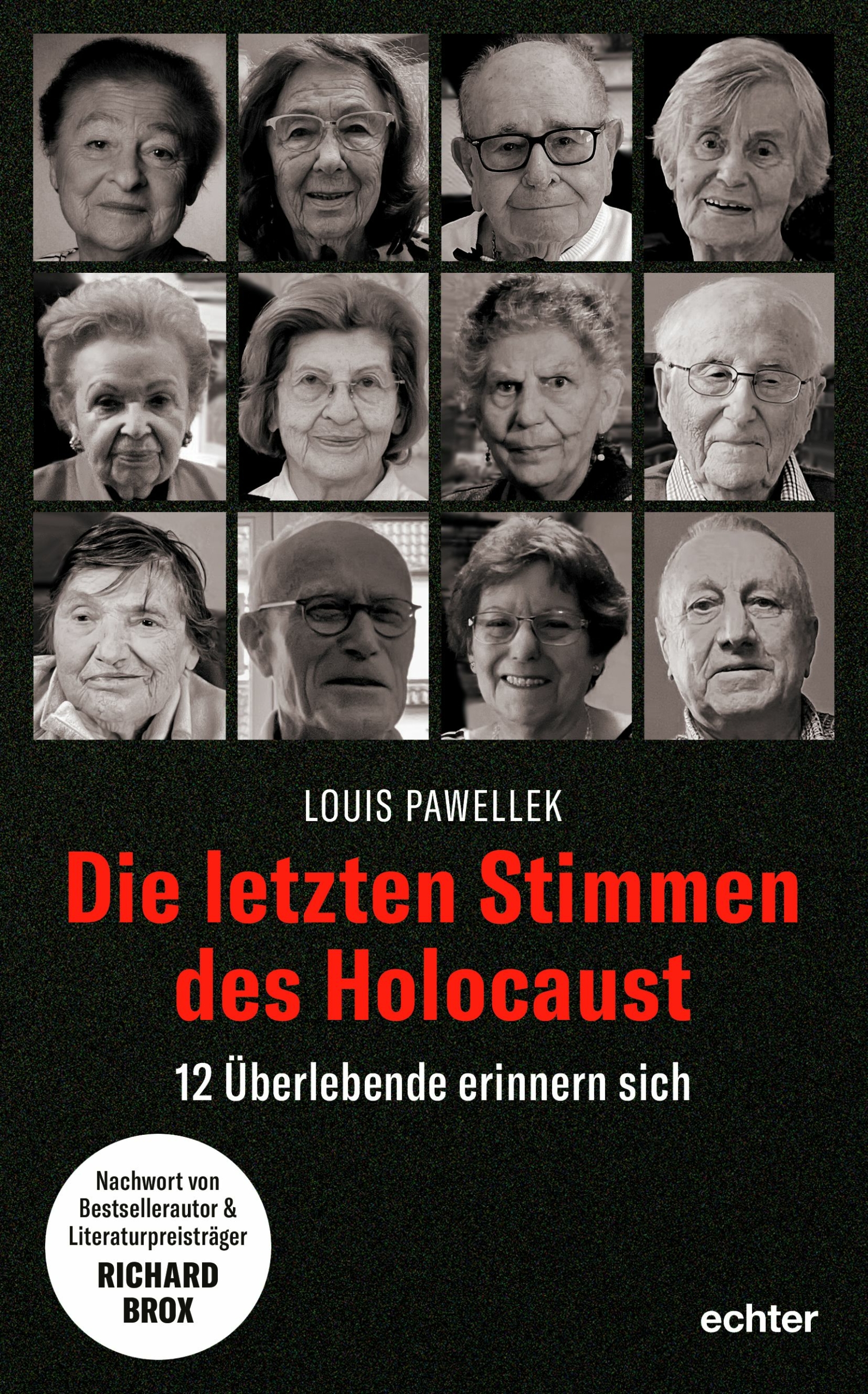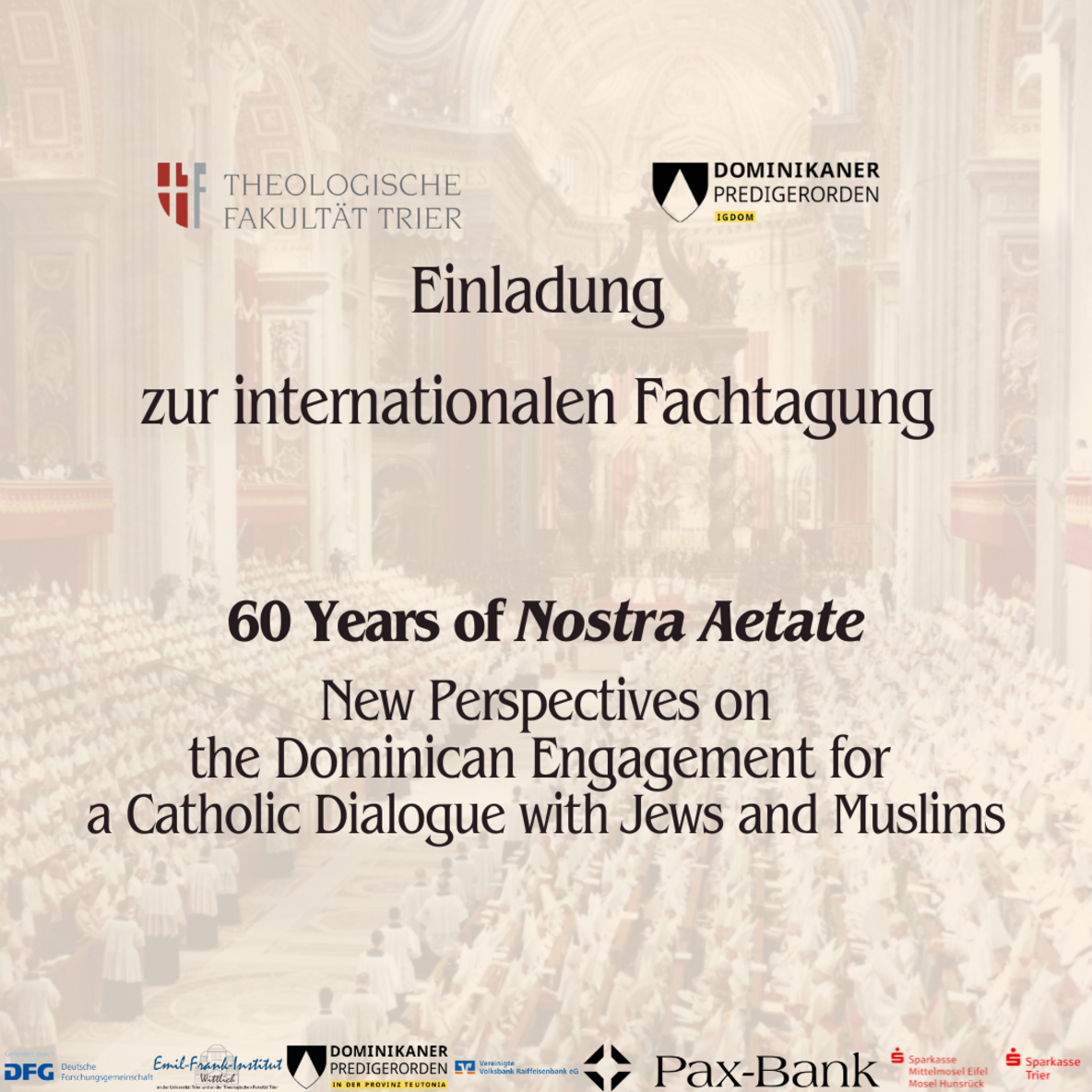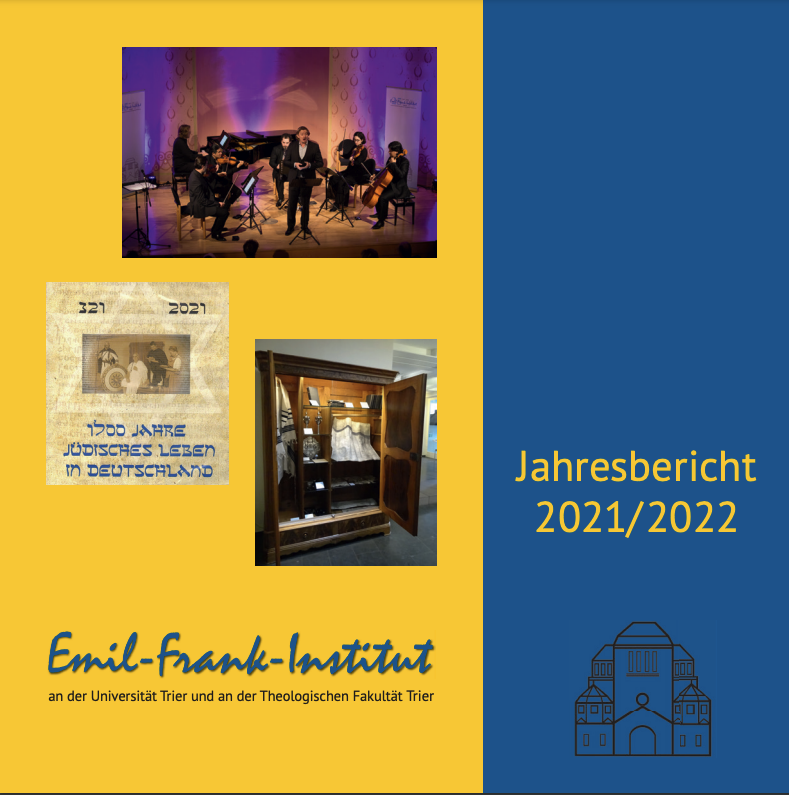17 Apr Führung zum Jüdischen Friedhof Wittlich
Gräber erzählen viel über das Leben der dort Begrabenen. In zwei Führungen können Sie anhand ausgewählter Gräber mehr erfahren über die Verstorbenen, ihre Familien sowie über jüdische Bräuche und Traditionen....